Der klassische Product Owner mag aussterben, aber der neue Product Owner wird zur Schlüsselfigur der digitalen Transformation – indem er oder sie mit KI-Agenten Produktarbeit neu ordnet. Doch wie könnte das aussehen?
Der Tag beginnt nicht mit einem Stand-up, sondern mit einem Briefing, das bereits vorliegt. Ein Research-Agent hat über Nacht interne Tickets, Support-Dialoge, Nutzungsdaten und öffentliche Quellen durchforstet, Widersprüche beseitigt und daraus eine kompakte Empfehlung gebaut: Wo wächst die Nachfrage? Welche Hürden fallen gerade? Wie groß ist die Lücke im Portfolio wirklich? Die ganze Herleitung findet sich im Audit-Log, alle Quellen sind verlinkt, die Risiken klar markiert.
Das Wichtige dabei: Es ist eigentlich egal, wer diesen Report erstellt, es ist nur wichtig, dass sie zuverlässig passiert – manchmal automatisch, manchmal durch Menschen, aber immer nach klaren Regeln und verbindlich. Mit dem großen Vorteil, dass manche Dinge – wie etwa diese umfangreiche Recherche um 4:00 Uhr morgens – nur dann Sinn ergeben, wenn sie von einer Maschine durchgeführt werden.
Das Ende des klassischen Product Owners
Gegen 9:30 liegen dann drei darauf basierende, klickbare Prototypen auf dem “Tisch”. Sie passen zum Markenbild, spielen aber bewusst mit verschiedenen Ansätzen: ein mutiges Layout für schnelle Conversions, eine konservative Variante für Bestandskunden, eine Mischform für mobile Erstbesucher. Was früher Tage im Design-Sprint verschlungen hat, geht heute in einem halben Vormittag über die Bühne, weil Maschinen die Entwurfsarbeit vorbereiten.
Statt Budgets für einzelne Tickets zu verwalten, geht es um Investitionen in die „Maschine, die die Software schreibt“.
Hier stirbt der klassische Product Owner. Der Mensch, der Tickets schreibt, priorisiert und durch Sprints jongliert, wird überflüssig. Nicht weil niemand mehr Entscheidungen trifft, sondern weil sich der Fokus fundamental verschiebt: weg vom händischen Pflegen einzelner Backlog-Einträge, hin zum Definieren von Zielen, Experimentierräumen, Erfolgskriterien und Risikogrenzen.
Aber der neue Product Owner wird gebraucht . Diese Rolle verantwortet nicht mehr einzelne Features, sondern das System, das Features hervorbringt. Statt Budgets für einzelne Tickets zu verwalten, geht es um Investitionen in die „Maschine, die die Software schreibt“ – um die Orchestrierung von Agenten, die Definition von Governance-Regeln, die Gestaltung von Feedbackschleifen und die kontinuierliche Verbesserung des gesamten Produktentwicklungssystems.
Die Wiederkehr der agilen Herausforderung
Auch die Entwicklung läuft anders als früher. Entwicklungsagenten zerlegen Ziele in kleine Häppchen, machen Vorschläge, schreiben Code, starten Tests, erstellen Pull Requests und schlagen passende Reviewer vor – die selbst wiederum ein anderer Agent oder ein Mensch sein können. Was am Ende wirklich in die Codebasis kommt, entscheidet ein Freigabeprozess. Auch der kann von Menschen besetzt sein oder automatisch laufen – je nachdem, was gerade sinnvoller ist.
Hier begegnet uns ein alter Bekannter in neuem Gewand: das Grundproblem der Agilität. Vor Jahren kämpften Unternehmen damit, Verantwortung vom Management an Teams zu übertragen. Das Management musste lernen, Teams mit den richtigen Zielen, Informationen und Mitteln auszustatten, damit diese autonom und schnell agieren konnten. Viele scheiterten daran, weil sie die Kontrolle nicht loslassen konnten oder die Teams nicht richtig befähigten.
Exakt dieselbe Herausforderung stellt sich jetzt mit KI-Agenten. Für hohe Geschwindigkeit und Adaptivität brauchen automatisierte Systeme die Fähigkeit, selbst zu entscheiden, zu evaluieren, zu priorisieren und sich zu verbessern. Sie benötigen dafür nicht nur Zugriffsrechte und Rechenleistung, sondern auch klare Ziele, verlässliche Informationsquellen und definierte Handlungsspielräume.
Der entscheidende Unterschied: Bei Agenten reicht es nicht, diese Dinge bereitzustellen und dann auf Selbstorganisation zu hoffen. Der neue Product Owner muss das Gesamtsystem aktiv gestalten, in dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten – mit all seinen Regeln, Schnittstellen, Kontrollpunkten und Lernschleifen. Er wird zum Architekten eines lebenden Systems, das sich selbst weiterentwickelt, innerhalb definierter Leitplanken, aber ohne Stopp-Schild und langsame Freigabeprozesse.
Von der Ticket-Verwaltung zur System-Verantwortung
Währenddessen läuft die Reality-Check-Maschine. Ein Analyse-Agent behält die Metriken fast in Echtzeit im Blick, erklärt Ausreißer und plant A/B-Tests. Rollouts starten mit klaren Abbruchregeln: Sobald eine Kennzahl zu stark abweicht, zieht das System die Reißleine – automatisch, bevor überhaupt jemand hinschaut. Bei heiklen Themen greift eine Eskalationskette: automatischer Stopp, Menschen einbeziehen oder beides, je nach Risikolevel.
Dass das alles funktionieren kann, liegt an mehreren Entwicklungen. KI-Systeme reagieren nicht mehr nur auf Befehle. Sie planen voraus, nutzen Tools, speichern Zwischenstände und arbeiten auf konkrete Ziele hin. Offene Schnittstellen wie MCP verbinden die Agenten mit der Unternehmens-IT – vom Git-Repository über CRM bis zur Buchhaltung. Zugriffsrechte bleiben dabei fein steuerbar und können jederzeit entzogen werden.
Das Wichtigste dabei: Governance findet da statt, wo sie hingehört – im laufenden Betrieb. Prüfungen, Kontrollen und Qualitätssicherung sind als wiederverwendbare Module im System eingebaut. Ob sie von Menschen oder Maschinen ausgeführt werden, hängt vom Risiko, vom Budget und vom jeweiligen Bereich ab.
Der neue Product Owner entscheidet nicht mehr: „Welches Feature bauen wir als Nächstes?“, sondern:
- Welche Autonomiebudgets bekommt welcher Agent?
- Wo verzinst sich mehr Exploration, wo braucht es mehr Verlässlichkeit?
- Welche Metriken triggern welche Eskalationen?
- Wie lernt das System aus seinen Entscheidungen?
- Wann und wie greifen Menschen ein?
Die pragmatische Zukunft
Klar, das geht nicht überall gleichzeitig. Wo die Datenqualität zu wünschen übrig lässt, rechtliche Fragen ungeklärt sind oder Systeme nicht richtig miteinander sprechen, bleibt der Mensch näher dran. Regulierung wirkt dabei weniger als Bremse, sondern eher als Leitplanke: Nachvollziehbarkeit und Schutzmaßnahmen werden zu Designprinzipien.
Teams berichten von einem typischen Muster: Am Anfang fühlt es sich zäh an, weil erst mal Erfahrungen gesammelt, Prozesse, Observability und Validations aufgebaut werden müssen. Genau wie bei der agilen Transformation vor Jahren: Erst mussten Vertrauen, Prozesse und Fähigkeiten aufgebaut werden. Aber sobald diese Grundlagen stehen, werden die Beschleunigungseffekte wirksam – und sogar planbar.
Die Arbeitskultur verändert sich spürbar. Ideen sind keine Mangelware mehr, sondern können durchgehend strömen und müssen sortiert werden. Diskussionen drehen sich weniger um Meinungen und mehr um messbare Szenarien: Was bedeutet Option A für Budget, Risiko und Time-to-Market im Vergleich zu Option B? Teams reden über Exposure-Limits und statistische Signifikanz, über Fairness-Checks und Audit-Anforderungen. Die Qualitätssicherung ist keine Heldentat Einzelner mehr, sondern eine Systemeigenschaft, die einfach inhärent gegeben ist.
Der neue Arbeitsalltag
Es zeigt sich ein pragmatisches Bild. In klar definierten, wenig regulierten Bereichen laufen komplette Entwicklungszyklen ohne dedizierte klassische Product-Owner durch – von der Recherche über Prototypen bis zum Rollout. Aber dahinter steht immer ein Mensch, der das System orchestriert, pflegt und weiterentwickelt.
In komplexeren Feldern bleibt die Rolle sichtbarer erhalten, aber sie wandelt sich: weniger Ticketverwaltung, mehr Zielsteuerung, Risikomanagement und Systemgestaltung. Der Schwerpunkt liegt auf der Verantwortung für die „Maschine, die die Software schreibt“ – auf Budgets für Agenten-Infrastruktur, Lernprozesse und Governance-Mechanismen statt für einzelne Features.
Der Arbeitsalltag wird dabei ruhiger und gleichzeitig anspruchsvoller. Morgens ein Update zu den Geschäftszielen, automatisch aus den aktuellen Zahlen abgeleitet. Dann ein Research-Briefing, das die wichtigsten Fragen schon beantwortet hat. Ein Prototyp, der als Experiment verstanden wird, nicht als finale Lösung. Code, der von Agenten vorbereitet und nach definierten Regeln freigegeben wird – mal durch Menschen, mal automatisch, mal beides. Ein A/B-Test, der von selbst stoppt, wenn die Ergebnisse zu schwach sind. Ein Dashboard zeigt zwei rote Warnungen: Datenschutz und Budget. Der Rest läuft und ist dokumentiert.
15 Minuten knallharter Fokus!
In je 15 Minuten alles, was Du wissen musst!
Im KI-Umfeld muss es schnell gehen. Deswegen bieten wir euch auch einen schnellen Einstieg in die wichtigsten Data-KI-Themen. 15 Minuten Fokus, immer mit wertvollen Einblicken und Erkenntnissen aus der Praxis.
Einfach kostenlos anmelden und sofort loslegen.
Die neue Verantwortung
KI und Agenten bedeuten hier nicht: Die Maschine macht alles allein. KI und Agenten bedeuten: Wir bauen Systeme, bei denen Kontrolle und Qualität garantiert sind – egal ob durch Menschen, Maschinen oder eine Kombination.
Der klassische Product Owner mag aussterben, aber der neue Product Owner wird zur Schlüsselfigur der digitalen Transformation. Er ist nicht mehr der Mensch zwischen Business und Entwicklung, der Tickets übersetzt. Er ist der Architekt eines lebenden Systems, das autonom agiert, aber menschliche Werte und Ziele verfolgt. Er gestaltet die Balance zwischen Autonomie und Kontrolle, zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit, zwischen Innovation und Stabilität.
Die Ironie dabei: Die agile Revolution, die einst den Product Owner hervorbrachte, wiederholt sich nun auf einer höheren Ebene. Damals ging es darum, Teams zu befähigen. Heute geht es darum, Systeme aus Menschen und Maschinen zu befähigen. Die Herausforderungen sind dieselben: Vertrauen aufbauen, Verantwortung übertragen, die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Nur die Akteure haben sich geändert.
Wer das ernst nimmt, wird nicht nur schneller liefern, sondern auch bewusster entscheiden. Mit weniger Gerede über Zuständigkeiten und mehr echter, transparenter, aktiver Verantwortung für das System, das Wert schafft. Der neue Product Owner verwaltet keine Tickets mehr – er verantwortet die Maschine, die aus Ideen Realität macht.

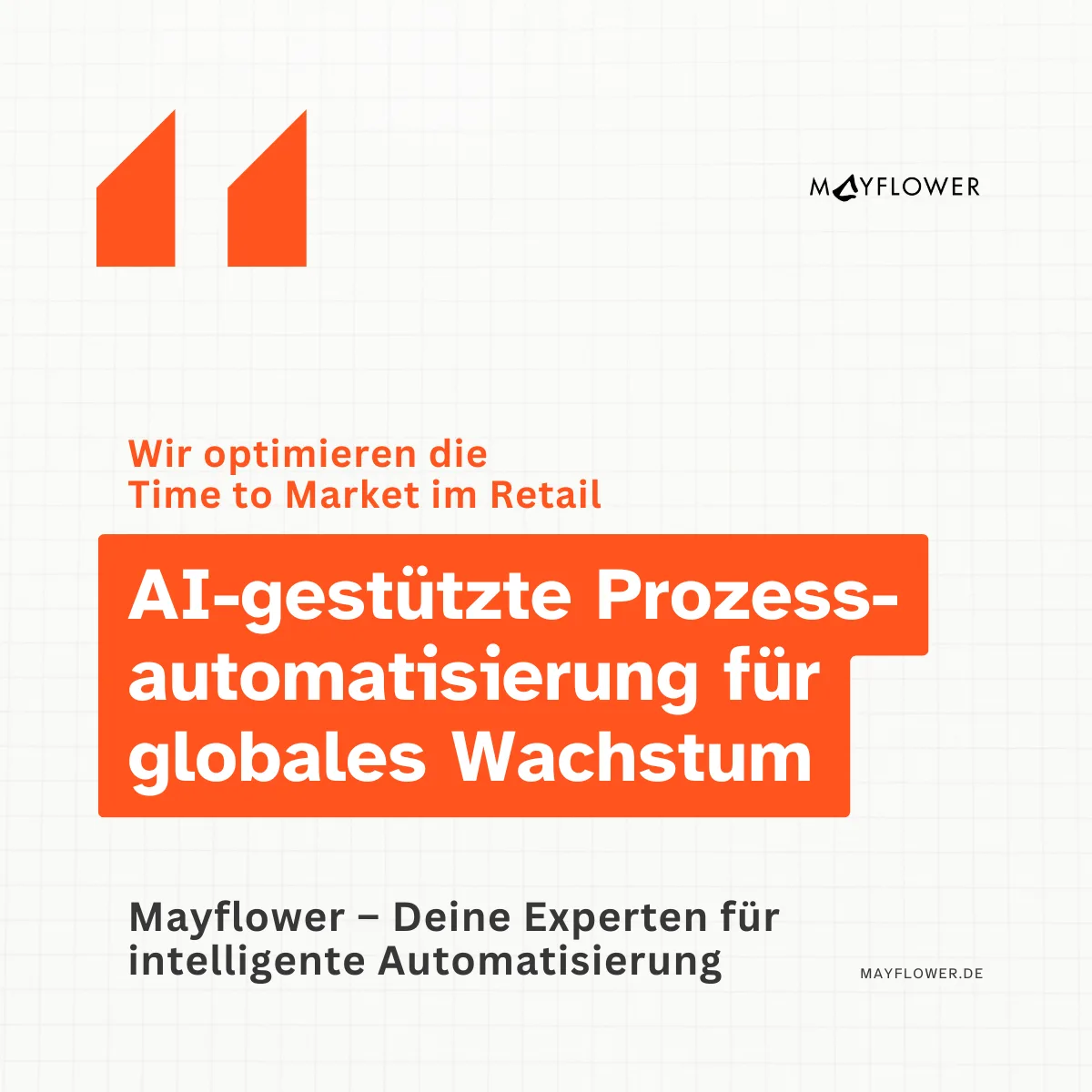
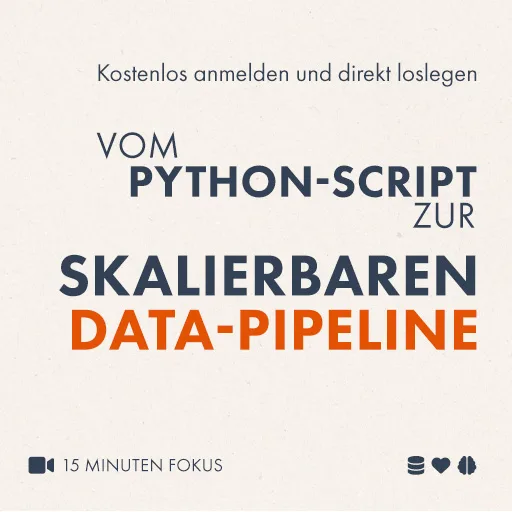

Schreibe einen Kommentar